Wer Wolfsburg hört, denkt natürlich an Volkswagen – jedoch ist Wolfsburg so viel mehr – findet der Vorstand des HWG (Haus, Wohnungs- und Grundstückseigentümerverein Wolfsburg und Umgebung e. V.). Es wird höchste Zeit das mehr Menschen mitzuteilen und dabei das zu nutzen, was oft ärgert – den Verkehr! „Das Image des Werkstandorts Wolfsburg ist veraltet, aber noch in vielen Köpfen. Und was eignet sich besser, als ein kostenloses Werbeschild an einer der meist befahrenen Straßen Europas?“, so Frank Kornath, Pressesprecher von HWG.
Gemeint sind die braunen Autobahnschilder (offizieller Begriff: touristische Unterrichtungstafeln) zum Beispiel an der A2 – die als touristische Hinweistafeln überall in Deutschland auf Besonderheiten hinweisen. Aktuell gibt es lediglich ein einziges braunes Schild für Wolfsburg – deutlich zu wenig, um die touristischen Highlights z.B. von Stadtteilen wie Fallersleben oder Vorsfelde angemessen zu würdigen – und Touristen anzuziehen.
„Ein einziges braunes Schild in Wolfsburg reicht bei weitem nicht aus, um auf unsere vielfältigen Sehenswürdigkeiten aufmerksam zu machen“, erklärt der HWG Geschäftsführer Adam Ciemniak. „Wolfsburg wird dieses Jahr 87 Jahre alt und ist somit Deutschlands jüngste Großstadt! Dennoch wird es Zeit Wolfsburg touristisch aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken“, meint Frank Kornath vom Wolfsburger Eigentümerverband. „Wir würden z.B. gezielt ein Schild für Fallersleben auf der A39 und A2 platzieren – dort, wo viele Pendler und Urlaubsfahrer vorbeikommen.“
Warum mehr braune Schilder sinnvoll sind
Eine empirische Studie der Hochschule Harz belegt: Jeder sechste Autofahrer besucht die beworbene Destination (geplant oder spontan), nachdem er ein solches Schild gesehen hat, und zwei Drittel erinnern sich anschließend genau an dessen Inhalt. Einprägsame Schilder steigern somit auch die Beachtung für unsere Stadt.
Bundesweit gibt es etwa 3.400 solcher Schilder, in Bayern allein über 800. Braunschweig verfügt über 3 (Zoo, Stadt, Herzog-Anton-Museum), Helmstedt verfügt über 5 (Grenzmuseum, Deutsche Teilung, paläon, Universitätsstadt Helmstedt, Elm-Lappwald) Sie sollen nicht nur informieren, sondern auch einen bewussten Reiseabzweig fördern. Jede spontane Ausfahrt stärkt lokale Gastronomie, Kultur und Einzelhandel – Studien sprechen von 10–20% mehr Umsatz in betroffenen Orten. „Das sollte sich Wolfsburg nicht entgehen lassen, vor allem weil wir so eine große Bandbreite von spannenden Attraktivitäten bieten,“ so Ciemniak.
Artikel und Kommentare, wie neulich vom Instagramer „El Hotzo“ stellen Wolfsburg sehr oft negativ dar, ohne je einen genaueren Blick auf Wolfsburg geworfen zu haben. Auch die Dehoga beklagt sinkende Gästezahlen. Die braunen Schilder sind somit eine hervorragende, langlebige und kostengünstige Möglichkeit auf Wolfsburg nachhaltig aufmerksam zu machen.
Aktuelles Schild in Wolfsburg: zu unkonkret
Unser einziges braunes Schild zeigt lediglich „die Erlebnisstadt Wolfsburg“ – ohne Bezug auf aufregende Stationen wie Fallersleben, Planetarium, Allersee, Kunstmuseum und vielen anderen Attraktionen. „Auch können sich Außenstehende unter dem jetzigen Bild nichts vorstellen. Laut den offiziellen Richtlinien müssen solche Schilder jedoch auf ein konkretes, erkundbares Ziel an der nächsten Ausfahrt verweisen – was beim derzeitigen Schild nicht der Fall ist,“ berichtet Kornath.
„Warum also nicht die Attraktionen und Sehenswürdigkeiten auf mehreren Schildern klar und deutlich sichtbar machen?“ fragt sich Adam Ciemniak. Auch touristische Highlights wie die Autostadt sollten ganz gezielt sichtbar gemacht werden, z.B. anlässlich des 25. Jubiläums der Autostadt. „Und mit der Hoffmannstadt Fallersleben haben wir auch historisch eine spannende Geschichte zu bieten!“ ergänzt Frank Kornath. „Echter Mehrwert entsteht erst, wenn wir passgenau – und nicht nur pauschal – auf unsere Schätze hinweisen,“ so der Geschäftsführer des HWG weiter. „Unsere Mitglieder sind gerne in Wolfsburg zu Hause und möchte das auch gern betont wissen! Und wer einmal bei uns Gast ist, wird sich wundern was es alles gibt um hier mindestens einen Kurzurlaub zu verbringen“, so Ciemniak abschließend.
HWG Wolfsburg appelliert daher an Verwaltung und Politik, gemeinsam Anträge an die (Landes- und Bundes-) Straßenverkehrsbehörde für neue Schilder zu stellen und eventuell auch Förderprogramme auszuloten. Die Schilder sollten an der Autobahn 39 und an der Autobahn 2, sowie an den Bundesstraßen 188 und 244 platziert werden.


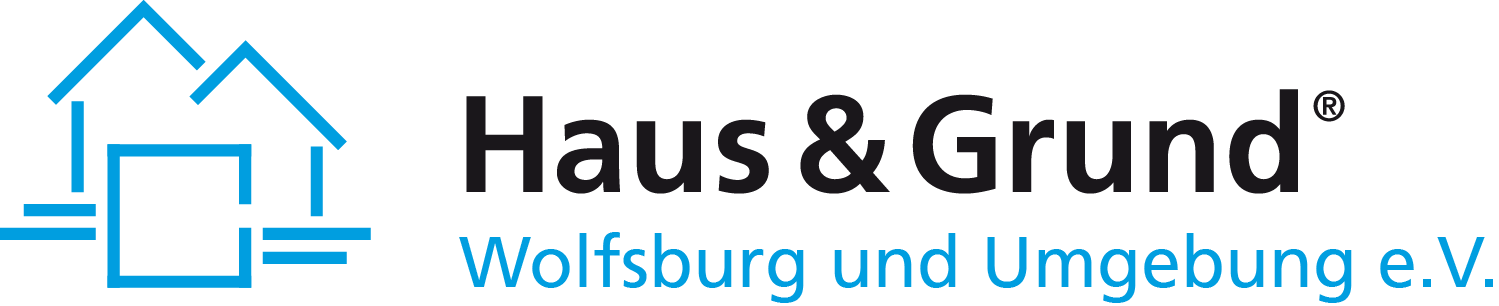





Neueste Kommentare